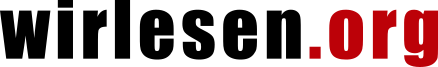Wiebke Porombka bloggt: Literaturkritikerdasein
Als ich neulich einen Abend mit Mehmet Scholl verbrachte, hat er mir nach dem zweiten Glas Wein gesagt, dass ich dringend etwas gegen meine Augenringe machen müsse. Ich war beinahe gar nicht beleidigt und habe ihm erklärt, dass er als Fußball-Experte das vielleicht nicht wissen könne, aber dass das leider unmöglich sei, und dass ich im Gegenteil an der Vertiefung eben dieser Augenringe kontinuierlich arbeiten würde, weil ich nicht nur Intellektuelle sei, sondern freie Literaturkritikerin. Das wiederum würde bedeuten, dass ich zwar den ganzen Tag ungewaschen im Bett liegen und lesen könne, dass ich aber über dieses Gelesene bis um eins, oft zwei Uhr nachts Texte schreiben müsse. Und dass, weil sich das Berliner Schulsystem noch immer nicht auf Literaturkritikerbedürfnisse eingestellt habe, der Wecker morgens um halb sieben klingeln würde, was der Gesamtlage nicht unbedingt zuträglich sei.
Und bevor Mehmet Scholl mitleidig nicken konnte, habe ich angefügt, dass mir allerdings diese ewige Klage vom prekären Dasein der freien Kritiker und Kritikerinnen, die so irre viel lesen müssten in viel zu kurzer Zeit und dabei so brutal schlecht bezahlt würden, wahnsinnig auf die Nerven ginge. Und dass es allenfalls ein Gerücht sei, dass man sich diese Tätigkeit nur leisten könne, wenn man über einen gut verdienenden Partner verfüge, der diesen Luxus querfinanziert und freundlich-milde lächelt, wenn man vom Honorar für die Rezension des letzten 600-Seiters zwei Kino-Karten spendiert. Dass das Dasein als freie Literaturkritikerin das schönste Dasein überhaupt sei, habe ich erklärt, und die dritte Runde Wein geordert.
Vergangene Woche allerdings, nachdem ich wie üblich die halbe Nacht durchgeschrieben hatte und am nächsten Morgen mit vor Müdigkeit wackligen Knien zur Wohnungstür ging, weil der Postbote mit einem Stapel neuer Herbsttitel dort stand, habe ich kurz wieder an Mehmet Scholl denken müssen und mich gefragt, ob er womöglich doch recht gehabt haben könnte. Zudem fragte ich mich, woran genau es gelegen hat, dass er mir nach unserem gemeinsamen Abend nicht seine Telefonnummer angeboten hat. Lange konnte ich darüber nicht grübeln, denn es klingelte schon wieder. Es war mein Nachbar. Dass er gerade ein Restaurant eröffnet habe und noch Personal suche, berichtete er mir. Und weil ich ja offenbar arbeitslos sei – ich sei ja immer Zuhause – wolle er mir nur rasch sagen, dass ich sehr gern bei ihm als Kellnerin anfangen könne. Ich bedankte mich höflich, denn mein Nachbar ist Schweizer und ebenfalls sehr höflich, und wollte schon ansetzen, ihm das Dasein einer freien Literaturkritikerin zu erläutern, sagte dann aber lediglich, dass ich leider ausgerechnet im Kellnern nicht sonderlich begabt sei.
Ich bin mir nicht sicher, was mein Nachbar wiederum einer gemeinsamen Nachbarin erzählt hat. Die jedenfalls stand vor der Tür, auf den Lippen die Farbe der Saison und im Arm ihr Neugeborenes, als es ein paar Tage darauf abermals klingelte. Ob ich am nächsten Vormittag auf die Kleine aufpassen könne, fragte meine Nachbarin und streckte das Kind ein Stück in die Höhe. Es sei alles ganz unkompliziert, sie bekäme eh das Fläschchen, stillen müsse ich nicht. Und bei Schreien einfach rumtragen.
In diesem Moment fauchte in der Küche die Espressomaschine, was tatsächlich nach einem veritablen Raubtier klingt. Das Baby zuckte erschrocken zusammen, und ich beeilte mich zu sagen, dass wir gerade ein bisschen Sorgen mit der Gasleitung hätten, aber dass ich mich umgehend melden würde, wenn der Schaden behoben sei. Bevor sie auf dem Absatz kehrt machte, drückte ich meiner Nachbarin eins der ausrangierten Leseexemplare in die Hand, die sich neben der Wohnungstür stapeln. Dann schäumte ich Milch auf, legte mich mit meinem Kaffee ins Bett und kontrollierte, was Google-News in Sachen Mehmet Scholl vermeldete.