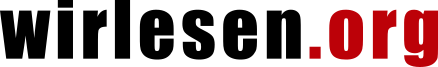Nadine Kegele bloggt: Das Recht auf Leidensstolz der Proletarität im Literaturbetrieb
Schriftstellerin zu sein hat sie glücklicher gemacht. Sie will (auch) das. Sie ist (auch) das. Sie kann (auch) das. Und sie traut sich (auch), das zu sagen. Ungehörig genug. Als schreibende Frau angesichts eines männlichen Kanons. Als proletarischer Mensch angesichts eines bürgerlichen Kanons. Als westlicher weißer Mensch angesichts eines weißen westlichen Kanons. Immerhin auf Rassismus ist Verlass, wenn schon Sexismus und Klassismus ihre Privilegien betreffend abstinken. (Dabei hat sie das beim In-den-Spiegel-Schauen lange nicht bemerkt, dass sie weiß ist. Able bodied zudem. Warum auch?) Duden fragt: „Meinten Sie Klassizismus?“ Weil auf diese Überempfindlichkeit kann Duden jetzt nicht auch noch eingehen. Klassismus? Über Privilegien spricht man nicht. Aber darf's ein bisschen Kunst sein? Habitus hier, Habitus da. Man erkennt sich. Es ist schwer, gläserne Decken zu durchbrechen mit dem falschen Kopf.
Wenn man arm ist, was sozial schwach genannt wird, was ökonomisch benachteiligt bedeutet, benötigt man immens viel Konzentration fürs Beschaffen von Notwendigem. Manchmal, weiß sie, gehört sogar die Notlüge dazu. Viel lügen müssen war ein gutes Training für ihr späteres literarisches Kreisen um jeglichen Stoff. Sie weiß, sie darf das Unglück, durch das sie sich gebildet hat, nicht anklagen. Doch Armut ist eine Verletzung, die nie heilt. Ist ganz normal, dass aus dieser Wunde Wut quillt. Auf jene, die darüber schweigen, dass vermögende Eltern ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Auf jene, die ihre Butterseite mit dem Mythos der Leistung argumentieren. Auf jene, die sich gegen das Sichtbarmachen ihrer Privilegien mit Negation zur Wehr setzen.
Sie interessiert sich. Weniger für die ewig ähnlichen Biografien von AutorInnen bei Wettbewerben, in Literaturprogrammen, auf Klappentexten. Vielmehr dafür, was Menschen vorfinden, um was draus machen zu können. Mit wie viel (ökonomischem, kulturellem, sozialem, symbolischem) Kapital jemand ins Leben und damit in den Literaturbetrieb startet. Wie durchlässig dieser Betrieb für wen ist. Sie interessiert sich sehr für eine Entmystifizierung von Intellektualität. Und findet außerdem, dass all jene, die bequem fallen, wenn sie fallen, versuchen sollen auszuhalten, dass der „Leidensstolz“*) der Proletarität eine politisch, soziologisch und literarisch ernstzunehmende, eine gleichwertige Stimme ist. Sie ist ich. Ich bin sie. Ich bin wütend. Ich bin neidisch. Neid ist peinlich? Neid ist kleinlich? Whatever. Das Beschämen muss zurückgeschlagen werden. Ich bin für mehr Wut zur Peinlichkeit in einem viel zu homogenen Betrieb. Für mehr Literatur von dort, wo „oben“ sagt, dass „unten“ sei.
*) Zitat aus einer Literaturrezension von „oben“: Iris Radisch über Anke Stellings „Schäfchen im Trockenen“