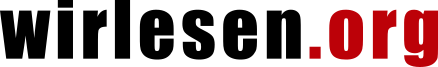Elisabeth Steinkellner bloggt: Lesungen für jugendliche Lesemuffel
Zum zweiten Mal bin ich heuer mit den LESERstimmen auf Lesetour durch Österreich unterwegs. Anders als 2015, als ich mit einem Kinderbuch mit dabei war, sind es diesmal Jugendliche von ca. 12 bis 14 Jahren, die an meinen Lesungen teilnehmen. Manchmal stelle ich zu Beginn der Veranstaltung die Frage, wer im Publikum gerne liest. In der Regel gehen dann zwei, drei Hände – meist sehr verhalten, fast peinlich berührt – hoch, während auf die Gegenfrage „Wer liest nur, wenn er/sie lesen muss?“ die restlichen Arme unter Gelächter nach oben schießen.
Als Schriftstellerin bin ich für ein solches Publikum, dem Bücher größtenteils gar nichts oder wenig bedeuten, wohl nicht per se eine spannende oder schillernde Erscheinung. Anders wäre es wohl, wenn ich behaupten könnte, starmäßig berühmt zu sein oder mit meinen Büchern megamäßig Geld zu scheffeln, denn zumindest die Frage nach dem Grad meines Ruhms und Reichtums ruft bei so manchem ansonsten gelangweilten Schüler (und es sind tatsächlich fast immer Burschen, die das wissen wollen!) kurzzeitig ein begeistertes Funkeln in den Augen hervor – zumindest für ein paar hoffnungsvolle Sekunden...
Nun drängt sich für mich natürlich die Frage auf: Was kann ich, als Autorin, lesemuffeligen Jugendlichen von 12 bis 14 Jahren in einer etwa einstündigen Begegnung eigentlich bieten, was ihnen mitgeben? Vielleicht bekommt zwar die eine oder der andere tatsächlich Lust, das vorgestellte Buch in der (Schul-)Bücherei auszuleihen und ihm noch eingehender Zeit zu widmen (juhuu!) – für den Großteil der Klasse wird die Beschäftigung mit dem Buch jedoch auf die 60 Minuten, in denen ich vor Ort bin, beschränkt bleiben.
Nun ja. Für mich steht jedenfalls fest, dass ich meinem jungen Publikum wertschätzend und auf Augenhöhe begegnen will. Egal, ob die Jugendlichen nun gerne oder gar nicht lesen, egal ob die Aussicht auf eine Lesung sie nun begeistert oder anpisst.
Zu einer wertschätzenden Haltung gehört für mich zum Beispiel, meine Texte „freizugeben“ für andere Interpretationen, auch für solche, die für mich vielleicht nicht nachvollziehbar sind; den Jugendlichen zu vermitteln, dass ihre Art der Auffassung eines Textes, ihre Phantasie, ihre Gedanken wertvoll, wichtig und interessant sind und außerhalb von Kategorien wie „richtig“ oder „falsch“ liegen; und nicht zuletzt: alle Fragen und Wortmeldungen wichtig und ernst zu nehmen. Wer etwas sagt oder fragt, verrät natürlich etwas über sich, und mit dreizehn oder vierzehn kann alles, was man über sich preisgibt, einen Gesichtsverlust bedeuten. Man lebt ja immer mit dem Risiko, von der ganzen Klasse ausgelacht zu werden. Zu der Scham, sich selbst zu zeigen, kommt außerdem noch die Scham, über gewisse Themen zu sprechen. Zuoberst rangiert wohl das Thema der Sexualität, aber ganz allgemein löst das Sprechen über Gefühle (auch über solche wie Trauer, Angst, Neid etc.) in der Zeit der Pubertät meist große Verunsicherung aus. In meinen Geschichten kommen diese Gefühle zur Sprache und ich versuche, sie auch in der anschließenden Diskussion klar zu benennen und mich so offen und authentisch wie möglich mit meinem Publikum über das Gelesene zu unterhalten.
Und vielleicht ist es in Zeiten der Selbstoptimierung und (digitalen) Selbstdarstellung, in der sich bereits Heranwachsende eine schillernde Selfie-Scheinexistenz aufbauen, umso wichtiger, den Versuch zu wagen, ihnen zu vermitteln: Trau dich, dich zu zeigen – aber als die Person, die du wirklich bist, mit allem, was dich ausmacht. Und vielleicht wäre das erfolgreichste Ergebnis überhaupt, wenn die Jugendlichen am Ende der Stunde ein Gefühl mitnehmen, das jenem aus Sophie Hungers Song „Birth-Day“ nahekommt: You're not a star, but you are, you are. And I'm not your fan, but I am, I am.