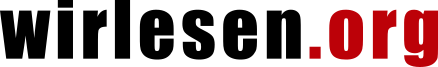Doris Knecht bloggt: Über das Schreiben und Sprechen darüber
Die meisten Menschen haben vom Schriftstellerinnen-Dasein eine recht klare Vorstellung: Die Schriftstellerin sitzt allein mit dem Werkzeug ihrer Wahl in einer stillen Kammer mit einer inspirierenden Aussicht davor und ein paar handschriftlichen Notizen daneben, sie trägt einen schwarzen Rollkragenpulli und eine Brille und schreibt unter Absolvierung einiger dramatischer, mit Selbstzerfleischung aufgeladenen Schreib-Blockaden an einem Roman, bis der Roman fertig ist. Und genau so ist es dann auch, nur meistens ohne die Aussicht. Und bis auf so Kleinigkeiten, wie, dass der Rollkragenpulli mitunter ein fleckiger Pyjama ist und der Verlag am Ende der Meinung sein könnte, der Romans sei noch gar nicht fertig, oder es wäre anders fertig besser, derlei, egal. Ich habe einen angenehmen Verlag, wenn ich sage: fertig, finden sie das ebenfalls. Insofern also ist die Vorstellung der allein vor sich hin arbeitenden Schriftstellerin und ihrer Brille schon richtig. Also, bis das Buch fertig ist.
Aber dann naht der Erscheinungstermin, und mit ihm lauter Anforderungen, die für Leute schwierig sind, die unter anderem deswegen schreiben, weil ihnen alles andere, als allein in einem stillen Zimmer vor einem Computer zu sitzen, nicht so liegt: Vor Leuten auftrteten, vor Kameras sprechen und posen, vorne sein, sich zeigen, sich produzieren.
Als mein erster Roman, „Gruber geht“, erschienen war, machte eine TV-Kultursendung einen Beitrag, in dem ich auch vorkam. Nicht so sehr wegen meines Romans, sondern weil Bob Dylan darin eine wichtige Rolle spielt, und Dylan wurde gerade 70; man suchte einen originellen Zugang zu seinem Geburtstag. Ich sagte zu, und ich traf mich mit einem Fernsehteam in der Kärntnerstraße. Sehr nette Menschen, freundlich und zuvorkommend. Sie sagten: Tja, sie brauchen Bilder. Ich sagte: Okay, klar. Wir wiederholten mehrmals einen Take, in dem ich die belebte Kärntnerstraße entlang ging und im Gehen mein eigenes Buch las, wie das Schriftsteller halt so machen. Danach las ich mitten am Graben laut aus meinem eigenen Buch die Stelle vor, in der Dylan vorkam. Schließlich gab ich ein Interview, in dem ich über mein Buch und Dylan interviewt wurde; welchen Dylan-Song ich während des Schreibens am öftesten gehört hatte oder welches mein liebster Dylan-Song sei, ich weiß es nicht mehr genau. Ich nannte „My Back Pages“ und„Girl from the Red River Shore“. Die Leute sagten, hmmmm, und baten mich, wenn es okay sei, einen anderen zu nennen, der als Soundtrack zu dem Beitrag besser passe, und als ich ein paar Tage später den Bericht im Fernsehen sah, hörte ich, dass dieser Song, „Things have changed“, mich zu dem Buch inspiriert habe, während ich zusah, wie ich die Kärtnerstraße entlang ging und mein eigenes Buch las.
Demnächst kommt ein neuer Roman von mir heraus. Ich habe mich schon mit zwei klugen, belesenen Fernseh-Redakteurinnen getroffen, denen klar ist, dass die Schriftstellerinnentätigkeit als solche eine eher unglamouröse und wenig herzeigbar ist. Sie gestalten zum Erscheinungstermin ein Porträt über mich. Das ist super. Jetzt bis auf dem Umstand, dass Fernsehen Bilder braucht, und Sprechen und Posen vor einer Kamera notwendig macht, aber; okay, wir kriegen das hin.