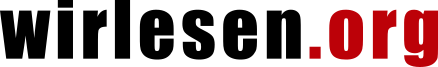Franzobel bloggt über Preisphobien, blinde Ameisen und Kohlen
Unlängst wurde ich gebeten, die Petition zur Errichtung eines österreichischen Buchpreises zu unterstützen. Schließlich gäbe es neben dem renommierten Deutschen auch schon einen Schweizer Buchpreis, wäre es höchste Zeit auch in Österreich … Was ist eigentlich eine hohe Zeit? Eine Schwangerschaft? … Jedenfalls, nein, ich wollte nicht. Mir geht diese ganze Auspreisung, diese monetäre Ausspeisung für Literaten, allmählich auf die Nerven. Der deutsche Buchpreis ist eine schreckliche Sache, eine fürchterliche Anmaßung, bestimmen zu wollen, welche die besten Romane einer Saison seien – bestimmt von mehr oder weniger zufällig ausgewählten Juroren, die dann – man weiß ja, wie so etwas läuft – auf Freundschaften, Verlage, Eigeninteressen, Positionierungen, Weißgottwas Rücksicht nehmen müssen.
Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich Thomas Bernhards Preisphobie. Ist doch jede Auszeichnung letzten Endes eine Einverleibung. Der Ausgezeichnete wird nicht gehoben, sondern auf das Niveau der Auszeichnenden heruntergezogen. Insofern geht mir auch der Literaturnobelpreis, die größte aller umgehängten Plätschen, am gluteus maximus vorbei. Sollen die fünf Aquavit berauschten Schweden doch alljährlich irgendeinen Dichter aus der sibirischen Tundra, der mauretanischen Savanne oder von einem tasmanischen Hochstand holen. Mir ist das schnurz. Ich richte meine Lektüreauswahl nicht danach. Und doch war der Autor, den ich hier empfehlen will, eine Weile lang seriöser Nobelpreiskandidat. Heute kennt man ihn, zumindest hierzulande, nicht mehr. Sein Meisterwerk „Die blinden Ameisen“ ist nur noch antiquarisch zu beziehen.
Um ehrlich zu sein, bin ich auch nur zufällig darauf gestoßen: Im Bücherschrank der toten Großmutter meiner Frau. Eine Gutenberg-Büchergilde-Ausgabe. Ramiro Pinilla? Noch nie gehört.
1963 auf Deutsch erschienen und von dva damals wie folgt beworben: "Ein englischer Kohlenfrachter zerschellt an der baskischen Küste. Zusammen mit den übrigen Einwohnern des Dorfes Algorta versucht auch die Familie des Bauern Sabas einen möglichst großen Teil der wertvollen Fracht an Land zu bringen, bevor die Zollgendarmerie die Ladung beschlagnahmen kann. Sabas hat anfangs Glück: Es gelingt ihm als einzigen, sein Strandgut nach Hause zu bringen und zu verstecken, bis er es dann, verfolgt von mißtrauischen [damals schrieb man das noch mit ß] Zollbeamten und von neidischen Nachbarn, doch wieder verliert. Die spannend erzählte Geschichte illustriert weniger gesellschaftliche Zusammenhänge als den dumpfen Schicksals- und Naturglauben nordspanischer Dörfler."
Es geht also um Kohlen. Das Wetter ist stürmisch, die See rau und Pinilla erzählt aus jeweils wechselnden Perspektiven der Familie Sabas all die Mühsal, die man auf sich nimmt, um bei Nacht und Regen einen ausgeliehenen Ochsenkarren mit Kohlen zu beladen. Ein behinderter Sohn kommt dabei ums Leben, ein anderer, vom Militär geflohen, rächt die Untreue seiner Freundin, indem er ihr Kohlen ins Bett schüttet, ein dritter Sohn versucht kleine Kätzchen vor der Ermordung zu retten, was misslingt, der alkoholkranke Onkel scheitert beim Versuch, für Kohlen etwas Schnaps zu bekommen. In einem ungeheuren Kraftakt hebt Sabas die Jauchegrube aus, um dort die Kohlen zu verstecken. Alles vergeblich. Ein gesamtfamiliärer, dreitägiger, nicht ohne Schläue gesetzter, schier unmenschlicher Kraftakt scheitert. Am Ende war alle Mühsal umsonst, bleibt der Familie nicht ein einziger Sack Kohlen, im Gegenteil, die Sabas‘ haben Prügel von eifersüchtigen Nachbarn bezogen und sich für das Ausleihen des Ochsenkarren verschuldet. Eine schöne Allegorie auf das menschliche Dasein. Ein wunderbares Buch.
Pinilla beschreibt die Mühsal so anschaulich, dass sie alleine dadurch Sinn erhält. Denn so ähnlich ist es mit dem Schreiben, es ist eine einzige Plage und am Ende wird man dafür von eifersüchtigen Kulturjournalisten abgewatscht. Trotzdem macht die Arbeit Sinn, auch wenn sie vergeblich ist, die Kohlen letztlich bei jemand anderem landen, der sie gar nicht braucht. Wir sind wie Ameisen, blind und unbedeutend. Wir arbeiten, weil wir nicht anders können. Preise sind dabei nichts anderes als der gebündelte Lichtstrahl einer Lupe, die Kinder auf uns richten. Ein Lichtstrahl, der zuerst wärmt, später verbrennt.