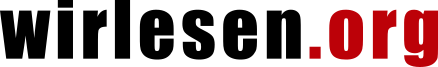Macht lesen gesund?
Literatur als Heilmittel
„Es tut wohl, den eignen Kummer von einem anderen Menschen formulieren zu lassen. Formulieren ist heilsam.“ Das meinte der Lyriker Erich Kästner in seinem Gedichtband „Doktor Kästners Lyrische Hausapotheke“, der 1936 erschien. Aber kann ein Buch, können ein Roman oder ein Gedicht tatsächlich praktische Folgen haben? Können sie, wie die Amerikaner so gern sagen, „inspirieren“, im echten, gelebten Leben Wirkung entfalten? Und Einsichten vermitteln? Was lernen von einer verheirateten Frau, die in der engen französischen Provinz von Größerem träumt, was von einem einbeinigen Kapitän, dessen einziges Lebensziel das Erlegen eines großen Wals ist, was von einem Buben, der den Mississippi hinunterfährt, was von einer großbürgerlichen jüdischen Familie aus der italienischen Stadt Ferrara, die unter den Rädern der Geschichte zermalmt wird? Kann uns ein römischer Poet, der vor 2000 Jahren starb, heute noch etwas sagen, das Lehren liefert fürs eigene Leben? Und wieso hat ein Roman des 19. Jahrhunderts, George Eliots „Middlemarch“, es vermocht, sich durch Immer-Wieder-Lektüre so eng mit dem Leben und Gefühlshaushalt der Engländerin Rebecca Mead zu verwickeln, dass das lange Buch durch drei Jahrzehnte hindurch zum Spiegel von Meads Wandlungen, Verwandlungen, Selbsterkenntnissen, Verlusten und erkannten Wahrheiten wurde?
Im Jahr 1980 hielt Adolf Muschg, der Schweizer Romancier und Professor für Germanistik an der ETH Zürich, eine Poetik-Vorlesung unter dem Titel „Literatur als Therapie?“ Er meinte dabei aber anderes als Doderer als ABC-Wärmepflaster, Balzac als Krückstock oder moralische Aufbauhilfe von Heinrich Böll. Muschg zielte nicht auf Lebenshilfe der platten Art ab. Sondern infolge der Lektüre auf Erweiterung und auf eine Bewegungsfreiheit der Phantasie, ja überhaupt auf Freiheit, auf Mut, auf Anreiz und auf Hilfe zur phantasievollen Selbsthilfe. „Die Kunst“, so Muschg, „hilft nicht. Aber sie ist da, wo uns nicht mehr zu helfen ist; wo Hilfe nicht mehr helfen kann, nur noch Dasein.“
Eine intellektuelle Rolle rückwärts machen Ella Berthoud und Susan Elderkin, denen für die deutsche Ausgabe die promovierte Germanistin und lit.cologne-Mitarbeiterin Traudl Bünger beisprang. In einer alphabetischen Lang-Promenade durch Bücher und die Weltliteratur von A wie Abschiede bis Z wie Zwanziger handeln sie in recht anregenden Miniessays Lebenslagen und Leiden ab. Hie und da etwas zu stark gerät ihnen aber der Hinweis auf Eigentherapie via Auswahlliteratur.
Literatur als Lebenshilfe
Bei Andrea Gerk, einer deutschen Journalistin und Literaturkritikerin, die vor allem fürs Radio tätig ist, wird anfangs weniger deutlich, wieso Literatur Lebenshilfe sein kann. Denn sie schreibt mehr über jene, die Bücher schreiben und darin Halt finden oder sich auch selber verlieren, wenn diese Stütze brüchig wird. Sie hat mit Autoren, Neurowissenschaftlern und Medizinern gesprochen, hat an Buchtherapiesitzungen teilgenommen, ist ins Kloster gegangen, examiniert Literatur als Gefühlslabor und wie sie beim Haftausbruch helfen kann. Das liest sich alles leicht. Lesen als Bibliotherapie und dessen psychosozialen Nutzen: Wäre da nicht unter Umständen ein Gespräch mit überzeugten Nicht-Lesern nützlich gewesen? (Allein schon, um zu sehen, was ihnen entgeht?)
Hilfe zur Selbsthilfe offeriert auch der „New York Times“-Reporter Benedict Carey. Sein Buch ist nicht zuletzt Gegenreaktion zu vielen nordamerikanischen Büchern der letzten Jahre, beispielsweise Amy Chuas „Die Mutter des Erfolgs“, die eine ganz bestimmte Bildungsmethode propagierten: den unerbittlichen unablässigen pausenlosen harten Lern-Drill für das Kind. Auf eigenen Erlebnissen und Misserfolgen beruhend, schreibt Carey, weswegen das Gegenteil, entspanntes Lernen nämlich und ein ruhigeres Angehen plus ausreichend Schlaf, vielversprechender ist. Merkwürdig zwiespältig ist aber dieser Band. Denn nach einer ehrgeizigen, spannenden Einleitung gefällt sich Carey bis zum Ende darin, Studie nach Studie zu rekapitulieren, ohne dass sich die Überzeugung einstellen will, dass „neues“ Lernen tatsächlich auch neu ist. Oder revolutionär. Oder Prokrastinieren, das Aufschieben und Aufschieben von Aufgaben, so verlockend, weil vielversprechend kreativ ist.
Literaturausräumen
Dass nicht nur Aufschieben, sondern auch Literaturausräumen ebenfalls eine Therapie sein kann, ist nicht von der Hand zu weisen. Es kann aber auch nach hinten losgehen. So setzte vor Jahren der Münchner Germanistikprofessor Bernd Scheffer auf einen positiven therapeutischen Effekt – und trennte sich von allen melancholischen Schriftstellern in seinen privaten Bücherregalen. Das Fazit: „Natürlich blieb kaum etwas von meinem Bestand an Spitzen-Belletristik überhaupt noch übrig. Die depressiven Dichter sind stark in der Überzahl, vor allem wenn es auf Qualität ankommt. Bedauerlicherweise habe ich auch wertvolle Erstausgaben von Paul Celan verscherbelt, und manches peinliche Missverständnis ist mir unterlaufen: Den ganzen Thomas Bernhard habe ich weggegeben, weil ich damals keine Ahnung hatte, dass Thomas Bernhard auch ein ungeheuer komischer Autor sein kann, jedenfalls für einen Leser, der dafür in Stimmung ist.“ Vor allem ernüchternd war am Ende die Einsicht: „Übrigens hat die Verbannung der Melancholiker aus der eigenen Bibliothek therapeutisch wenig gebracht.“
Überlebensnotwendigkeit von Literatur
Dass eine literarische Hausapotheke überlebensnotwendig sein kann, davon erzählte in seiner Autobiografie einer der bekanntesten Literaturkritiker deutscher Sprache der vergangenen fünfzig Jahre. 1941, im Ghetto von Warschau, verliebten sich eine Frau und ein Mann, beide Juden, beide große Musik- und Literaturliebhaber, ineinander. Da er sich einen 1936 publizierten Gedichtband nicht leisten konnte, schrieb sie für ihn die Verse ab, garnierte ihre Abschrift mit Zeichnungen und schenkte dies, von eigener Hand gebunden, ihm zum Geburtstag. Das Buch war „Doktor Kästners Lyrische Hausapotheke“. Als Marcel Reich-Ranicki davon fast sechs Jahrzehnte später in seinen Memoiren berichtete, fügte er hinzu, er habe Kästner 1957 persönlich kennen gelernt, ihm die Geschichte von sich, seiner Frau Teofila und von Kästners Buch erzählt und was es ihnen während der Ghetto-Zeit bedeutet habe. Erich Kästner sollen die Tränen in die Augen gestiegen sein. Weil hier Literatur Überlebensrettung war. Und heilte.
„Die Kunst hilft nicht. Aber sie ist da, wo uns nicht mehr zu helfen ist; wo Hilfe nicht mehr helfen kann, nur noch Dasein.“ (Adolf Muschg)
Literatur
- Ella Berthoud und Susan Elderkin mit Traudl Bünger Die Romantherapie. 253 Bücher für ein besseres Leben. Insel, Berlin 2014. 432 Seiten.
- Benedict Carey: Neues Lernen. Warum Faulheit und Ablenkung dabei helfen. Rowohlt, Reinbek 2015. 352 Seiten.
- Andrea Gerk: Lesen als Medizin. Die wundersame Wirkung der Literatur. Rogner & Bernhard, Berlin 2015. 344 Seiten.
- Rebecca Mead: My Life in Middlemarch. Crown, London 2014. 304 Seiten.
- Harry Eyres: Horace and me. Life Lessons from an ancient poet. Bloomsbury, 20014. 256 Seiten.
Links
http://www.medienobservationen.lmu.de/artikel/allgemein/allgemein_pdf/scheffer_therapie.pdf